Wir waren schon mal hier in der Buchenstraße, die es heute nicht mehr gibt (mittendran am 16. August 2021), haben aber das Haus des Malers und Professors an der Akademie, Carl Gussow (1843-1907) noch nicht gezeigt (Bild 1). Heute besuchen wir die Ateliers des Künstlers in diesem Haus, die er nicht nur für seine Malerei benutzte, sondern in der er auch eine Malschule betrieb. Viele seiner Adepten waren Frauen, die trotz ihrer Begabung keinen Studienplatz an der Akademie bekamen und daher auf eine private Ausbildung angewiesen waren, beim Verein Berliner Künstlerinnen in der Potsdamer Straße (mittendran vom 21. November 2021) und eben bei einzelnen angesehenen Künstlern wie Carl Gussow oder Hans Baluschek (1870-1935) (mittendran vom 27. Januar 2024).
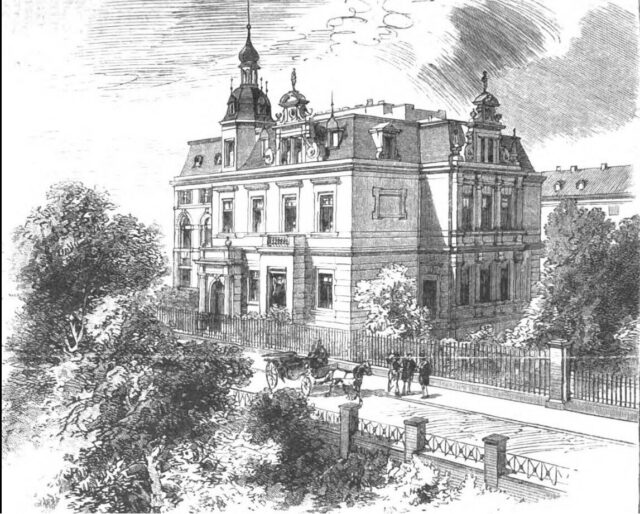
Bild 1. Die Villa Gussow in der Buchenstraße 2 (Quelle: Illustrierte Zeitung, Band 84, 1885, Seite 213, gemeinfrei).
Carl Heinrich Julius Gussow (Bild 2) war am 25. Februar 1843 in Havelberg zur Welt gekommen, wie sein Zwillingsbruder Friedrich; vermutlich waren sie eineiige Zwillinge, folgt man einer Quelle, nach der sie sich in der Kindheit so ähnlich waren, dass sie oft verwechselt wurden (1). Sie waren Söhne des Baurats Julius Eduard Gussow (1808 – 1872) und seiner Frau Johanna Friedericke, geborene Becker (1841-????). Julius Gussow wiederum kam aus einer Berliner Familie, war Sohn des Königlichen Geheimen Kanzleirats Carl Friedrich Gussow und dessen Ehefrau Marie Louise Kracht aus Berlin, wenngleich die Herkunft der Familie Gussow aus dem Ort Gussow im Dahme-Spree-Kreis wahrscheinlich ist. Wenig mehr ist zu erfahren über Carl Gussow (1,2): sein künstlerischer Lebensweg über Weimar, München und Karlsruhe nach Berlin, und von dort schließlich wieder nach München, wo er 1907 verstarb; und dass Max Klinger (1857 – 1920) sein bester Schüler war, der ihm von Karlsruhe nach Berlin folgte. Gussow hatte eine Ehefrau, die als schön galt und die er gemalt hatte. Deren Bild findet sich in einigen wenigen Publikationen (Bild 3), sie hat dort aber keinen Namen, nicht zu reden von Herkunfts- und Lebensdaten. Auch Kinder werden nicht erwähnt, als spiele dies alles für die Einschätzung seiner Kunst keine Rolle. Ein schnelle genealogische Recherche bringt mehr zutage als die einzige ernstzunehmende Publikation mit „Erinnerungen an Carl Gussow“ von Archivar Dr. Walther Stephan (1873-1959), dem Bruder von Carl Gussows Schwiegersohn Paul Oskar Stephan (1). Er hätte es besser wissen können, aber dem war wohl vor allem daran gelegen, den Wert der in der Familie gesammelten Gussow-Werke zu dokumentieren und zu steigern – das Manuskript blieb allerdings ungedruckt und vereinsamt in der Kunstbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Wichtigste daran ist wohl die Listung von insgesamt 140 Skizzen und Bilder Carl Gussows im Anhang mit Titel, Größe, Art, Eigentum, Provenienz. Im Folgenden also vor allem das, was bislang ungesagt und ungeschrieben geblieben ist.

Bild 2: Carl Gussow, fotografiert von Wilhelm Fechner (1835–1909) (Quelle: Velhagen und Klasings Monatshefte. Jg. 21 (1906/07). Bd. 2, Heft 10, Juni 1907, S. 492; gemeinfrei).
Am einfachsten ist noch die akademische Karriere von Carl Gussow zu rekonstruieren, Akademiker aller Fächer sind meist sehr zwanghaft in der Dokumentation von Lebensläufen und -ereignissen und ihren Erfolgen: Schulausbildung bis kurz vor dem Abitur am Gymnasium Francisceum in Zerbst, einer ehemaligen Klosterschule. Danach Kunststudium für kurze Zeit in Berlin, dann in Weimar von 1861 bis 1866, wo er einer der drei ersten Studenten war; sein Zwillingsbruder ging 1862 zum Militär. Aus seiner Zeit in Weimar stammt seine Bekanntschaft mit Paul Thulmann (1834-1908), mit dem er gemeinsam die 1869er Auflage von Goethes Wahlverwandschaften illustrierte. Es folgte ein Abstecher nach München 1867 und ein längerer Italienaufenthalt in Venedig, Mailand, Florenz. Er kehrte 1870 zurück nach Weimar und erhielt eine Berufung an die dortige Kunstschule als Professor für Historienmalerei – er war erst 27 Jahre alt; in dieser Zeit war der fünf Jahre jüngere Max Liebermann (1847-1935) sein Schüler. Im Jahr 1874 folgte die Berufung nach Karlsruhe an die Großherzogliche Badische Kunstschule, aber bereits ein Jahr später (1875) ging er auf Einladung von Anton von Werner (1843-1915), dem neuen Direktor der Berliner Königlichen Akademie der Künste, an die Hochschule für Bildende Künste als Professor und Leiter der Malklasse II; auch Thulmann wurde nach Berlin berufen. Acht Jahre später (1883) ließ sich Gussow von seinen akademischen Lehrverpflichtungen entbinden und betrieb für weitere neun Jahre eine private Malschule in seinem Hause in der Buchenstraße 2. Im Jahr 1892 übersiedelte er nach München-Pasing, und wohnte – zusätzlich – bis zu seinem Tod 1907 in Obersalzberg bei Berchtesgaden. In all der Zeit malte er ausgiebig, stellte Bilder auf Kunstausstellungen aus, eckte wegen seiner hyper-realistischen Genre-Darstellungen von Menschen und Situationen mehr als einmal an. Er galt als Modemaler einerseits (3), als „derb“, drastisch und unkonventionell wie seine Bilder andererseits (1), wurde aber gerade deswegen auch von seinen Schülern und Schülerinnen geliebt. Verkauft hat er viele seiner Bilder ins Ausland, vor allem nach England.

Bild 3. Hermine Gussow geborene Bethmann, gemalt von Carl Gussow. Das Bild findet sich in verschiedenen Quellen, meist aber wird der Name der Gemalten nicht genannt (Quelle (1), gemeinfrei).
Sein Familienleben sah zunächst genau so einfach strukturiert aus, zumindest legt das der handgeschriebene Lebenslauf von Carl Gussow in der Personalakte der Akademie der Künste nahe (4): zwei Kinder (Elisabeth, Maria) aus erster Ehe (1870) mit Johanne Schultz, zwei Kinder (Margarethe, Eva) aus der zweiten Ehe (1874) mit Hermine, geborene Bethmann; ein weiteres Mädchen war 1875 nach wenige Tagen verstorben. Sucht man dagegen die beiden Ehefrauen und die vier Kindergeburten (in Weimar, in Karlsruhe oder in Berlin), lässt sich das älteste der Kinder (Elisabeth) in den diversen Genealogieforen (Ancestry, Geni, FamilySearch) partout nicht auffinden. Da hilft nur, die Originaleinträge in den Kirchenbüchern zu studieren, auffindbar bei Archion, dem Kirchenbuch-Portal der evangelischen Kirche (5). Und das bietet einige Überraschungen.
Zum einen: Der Heiratseintrag vom 5. Dezember 1870 in Weimar vermerkt, „die Verlobten erhalten laut Recript [Erlass, PE] vom 1. Dezember 1870 vom Großherzoglichen Kirchenrath Dispensation zur stillen Trauung ohne alles Aufgebot„. Das wirft die Frage auf, ob die Braut vielleicht zu diesem Zeitpunkt sichtbar schwanger war und man deswegen auf jegliche Öffentlichkeit verzichtet hatte – entsprechend den Moralvorstellungen dieser Zeit. Da aber das zweite Kind (Maria) bereits am 15. November 1871, 11 Monate später, geboren wurde, scheint dies biologisch fast unmöglich; dann aber muss das erste Kind vorehelich geboren worden sein. In der Tat berichtet der Geburtseintrag von Maria, dass sie das erste eheliche Kind, aber das zweite Kind der Johanne Schultz sei. Da Carl Gussow aber erst 1870 aus Italien zurückgekommen war, warf dies die Frage auf, ob das erste Kind vielleicht in Italien zur Welt gekommen sein mag. Dass aber ein unverheiratetes Paar nach und in Italien reist, sie noch dazu schwanger, erschien uns noch unwahrscheinlicher. Erst als das Zeitfenster erweitert wurde auf die Zeit vor dem Umzug nach München und der Italienreise wurden wir fündig: Elisabeth wurde am 19. Oktober 1865 geboren, unehelich zwar, aber der Vater war benannt und hatte die Vaterschaft anerkannt. Carl Gussow war noch Student und 22 Jahre, sie war 24 Jahre alt, geboren am 29. Dezember 1841 in Weimar. Die Geburt und Taufe fand nicht in Weimar statt, sondern im 80 km entfernten Stöcking (Langenbernsdorf) südöstlich von Weimar, schon in Sachsen. Dies geschah vermutlich, um der unverheirateten Johanne Schultz die „Schande“ zu ersparen, sitzengelassen worden zu sein – immerhin verschwand der Vater für fast fünf Jahre aus ihrem Leben und aus dem Lande.
Unter diesen Umständen überraschte es schließlich nicht, im Heiratseintrag von 1870 eine spätere, im März 1874 zugefügte Beischrift zu finden, die gleich zwei wichtige Informationen enthielt: Zum einen wurde offensichtlich bereits am 19. Januar 1874, also etwas mehr als 3 Jahren nach der Geburt des zweiten Kindes, die Ehe von Carl Gussow und seine Frau Johanne geborene Schultz geschieden. Zum anderen notiert die Beischrift, dass „der Frau Professor Gussow als dem unschuldigen Theil die Wiederverehelichung nachgelassen [i.e. erlaubt, PE], der Ehemann aber zur Tragung und Erstattung der sämmtlichen Prozeßkosten verurteilt worden„. Mit anderen Worten: Carl Gussow hatte einen Ehebruch begangen, der seine Ehefrau veranlasst hatte, die Scheidung einzureichen, und dem hatte das Kirchengericht stattgegeben. Ob dieser „Seitensprung“ mit seiner zweiten Ehefrau Hermine Bethmann stattfand, die er 1874 in Karlsruhe heiratete, entzieht sich der Möglichkeit der Recherche.
Carl Gussow kam im Jahr 1875 nach Berlin und wohnte bis zum Umzug in seine eigene Villa zur Miete am Magdeburger Platz 4, hinter der Markthalle. Die Villa in der Buchenstraße 2, die er bauen ließ, war Teil des Kielgan´schen Villenplans (mittendran vom 6. April 2021). Die fünf Villen in der Buchenstraße wurden zwischen 1880 und 1888 gebaut (mitteldran vom 16. August 2021) und mehrheitlich von Künstlern (Gussow, Herter, Schaper) bewohnt (6). Das Grundstück Nr. 2 hatte zunächst Dr. Julius Bergmann gehört, einem Philosophen, der nach Promotion in Berlin 1875 auf eine Professur an die Universität Marburg berufen worden war und von dem Carl Gussow das Grundstück 1880 erwarb (7), nachdem es zuvor geteilt worden war. Architekten des Wohnhauses waren Kayser & von Großheim, die in dieser Zeit viele Villen prominenter Bürger, aber auch Geschäftshäuser und öffentliche Gebäude entwarfen, z.B. das Gebäude des Universität der Künste in der Hardenbergstraße (8). Nach Fertigstellung 1881 übertrug Gussow die Immobilie seiner Ehefrau.
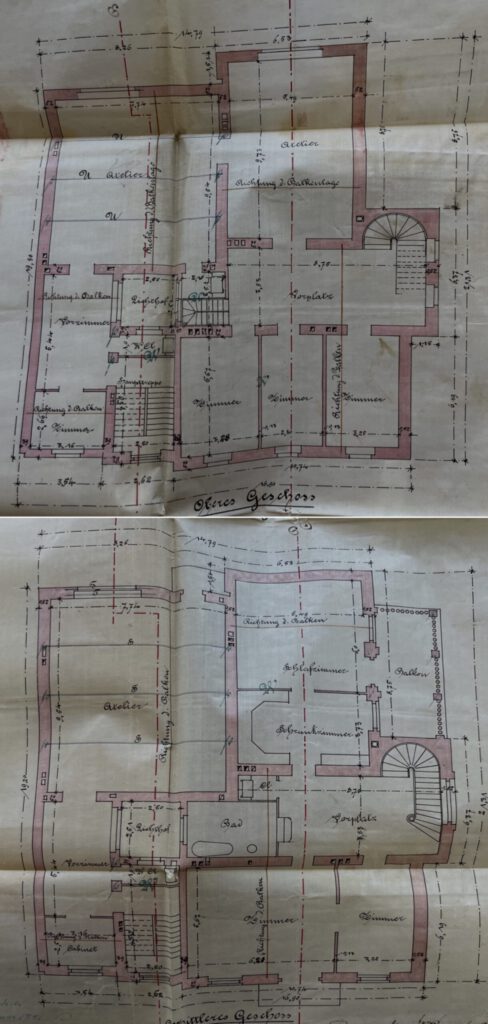
Bild 4. Grundriss der 1. (unten) und 2. Etage der Villa Gussow mit den drei Atelierräumen. Im Erdgeschoss befanden sich die Wohn- und Essräume (aus: (7)).
Das Haus hatte eine Grundfläche von mehr 300 qm (19x16m) und drei Etagen (Bild 4); es war außerdem voll unterkellert, hatte also insgesamt etwa 1200 qm. Im Erdgeschoss befanden sind die Wohn- und Essräume der Familie, im ersten Stock die Schlafräume sowie ein 74 qm (7,74 x 9,54 m) großes Atelier nach Süden, und im zweiten Stock zwei weitere große Atelierräume von 74 und 52 qm sowie mehrere kleinere Zimmer. Im Keller waren Funktionsräume (Küche, Speisekammer, Waschküche etc.) untergebracht, vermutlich auch eine Personalstube. Nachträglich angebaut wurde nach kurzer Zeit (1883) noch eine Terrasse und eine Veranda. Und wie alle Villen im Kielgan-Viertel hatte es eine dekorative Fassade (Bild 5).

Bild 5. Fassade der Villa Gussow (aus: (7).
Die Planung von drei Atelierräumen mit insgesamt fast 200qm Grundfläche bereits vor 1880 lässt sich nicht allein durch Gussows eigene Mal-Ambitionen erklären. Sie erlaubt auch die Vermutung, dass die Aufgabe der Lehrtätigkeit an der Akademie der Künste im Jahr 1883 keineswegs eine spontane Entscheidung war, sondern einem Plan folgte, der bereits vorher gefasst worden war, nämlich statt des Unterrichts an der Akademie eine eigene Malschule zu eröffnen. Im Internet werden in diversen Quellen 45 Künstlerinnen und 13 Künstler genannt, die bei Carl Gussow Kunstunterricht erhielten, darunter viele, die später eine eigene Karriere in der Kunst begründeten, wie beispielsweise Max Liebermann (1847-1935), Max Klinger (1857-1920) und Max Petsch (1840-1888) bei den Männern, und Anna Costenoble (1863-1930), Clara von Rappard (1857-1912) und Ottilie Roederstein (1859-1935). Auch seine Ehefrau war seine Schülerin gewesen, sie war auch Mitglied im Verein der Berliner Künstlerinnen (9). Wir konnten in einer früheren Recherche (6) eine weitere Künstlerin hinzufügen und deren Leben rekonstruieren, Elisabeth Lüderitz (1858-1930). Die Liste ist vermutlich nicht vollständig: Wie regelmäßig beim Verein Berliner Künstlerinnen wurde auch bei Gussow ein Kostümfest der Künstlerinnen veranstaltet, bei dem allein 1882 fünfzehn Schülerinnen anwesend waren (Bild 6). Und dass es mehrheitlich Frauen waren, die bei Gussow ausgebildet wurden, lag an der Berliner Akademie der Künste und dessen Leiter Anton von Werner, der die Zulassung von Studentinnen bis zu seinem Ableben 1915 verhinderte.

Bild 6. Künstlerinnenfest im Damenatelier Karl Gussows mit Ottilie Roederstein als Schiller verkleidet (Mitte stehend), Fotograf: Carl Segert Berlin, Januar 1882 (Quelle: Wikipedia, gemeinfrei).
Als die Gussows nach München übersiedelten, verkauften sie 1892 das Haus an den Berliner Bankier und Kunstmäzen, Generalkonsul Paul Freiherr von Merling (1853-1924); ein Jahr später wechselte das Haus schon wieder den Besitzer und erneut 1916 und 1927. Zuletzt betrug sein Wert 300.000 Reichsmark. Das nach dem Zweiten Weltkrieg vererbte Grundstück wurde 1966 zu einem Preis von 115.000 DM an die Stadt Berlin verkauft, die es im Rahmen eines komplexen Grundstückstausch zur Errichtung des Französischen Gymnasiums verwendete – dazu ein andermal mehr.
In Pasing hatten die Gussows ein eher beschauliches Häuschen, verglichen mit der Villa in Berlin, aber in Obersalzberg bei Berchtesgaden wohnte die Familie zur gleichen Zeit komfortabel in der „Villa Gussow“, die 1927 an den Klavierfabrikanten Edwin Bechstein verkauft wurde. Hier heiratete seine Tochter Maria aus der ersten Ehe im Jahr 1898 den Gutsbesitzer Paul Oskar Stephan (s. oben); die jüngste Tochter, Eva, geboren am 25. Mai 1879 noch in Berlin, heiratete einen Wissenschaftler der Berliner Akademie der Wissenschaften, Dr. phil. Hans Otto von Fritze (1869-1919); sie hatten eine Tochter, 1906 in Berlin geboren. Die weitere Nachkommenschaft haben wir nicht mehr recherchiert. Carl Gussow starb am 27. März 1907, sein Zwillingsbruder „Fritz“, ein Oberstleutnant a.D., der „Held von Düppel“ (12), starb im April 1914 ebenfalls in Obersalzberg, und Hermine, seine Frau, verstarb am 6. März 1922 in München.
Die siebzehn Jahre von Carl Gussow in München sind weit besser dokumentiert als die gleiche Anzahl von Jahren in Berlin (1875-1892), betrachten doch die München Kunsthistoriker Carl Gussow als einen der ihren, der Münchner Malerschule zugehörig (10), auch wenn er dort, mehr noch als in Berlin, privatisiert hatte. Sein gebrochenes Verhältnis zur Berliner Malschule und -tradition und deren historisch-klassizistische Fixierung drückt vielleicht am besten das bereits 1878 entstandene Gemälde „Die Venuswäscherin“ (Bild 7) aus.
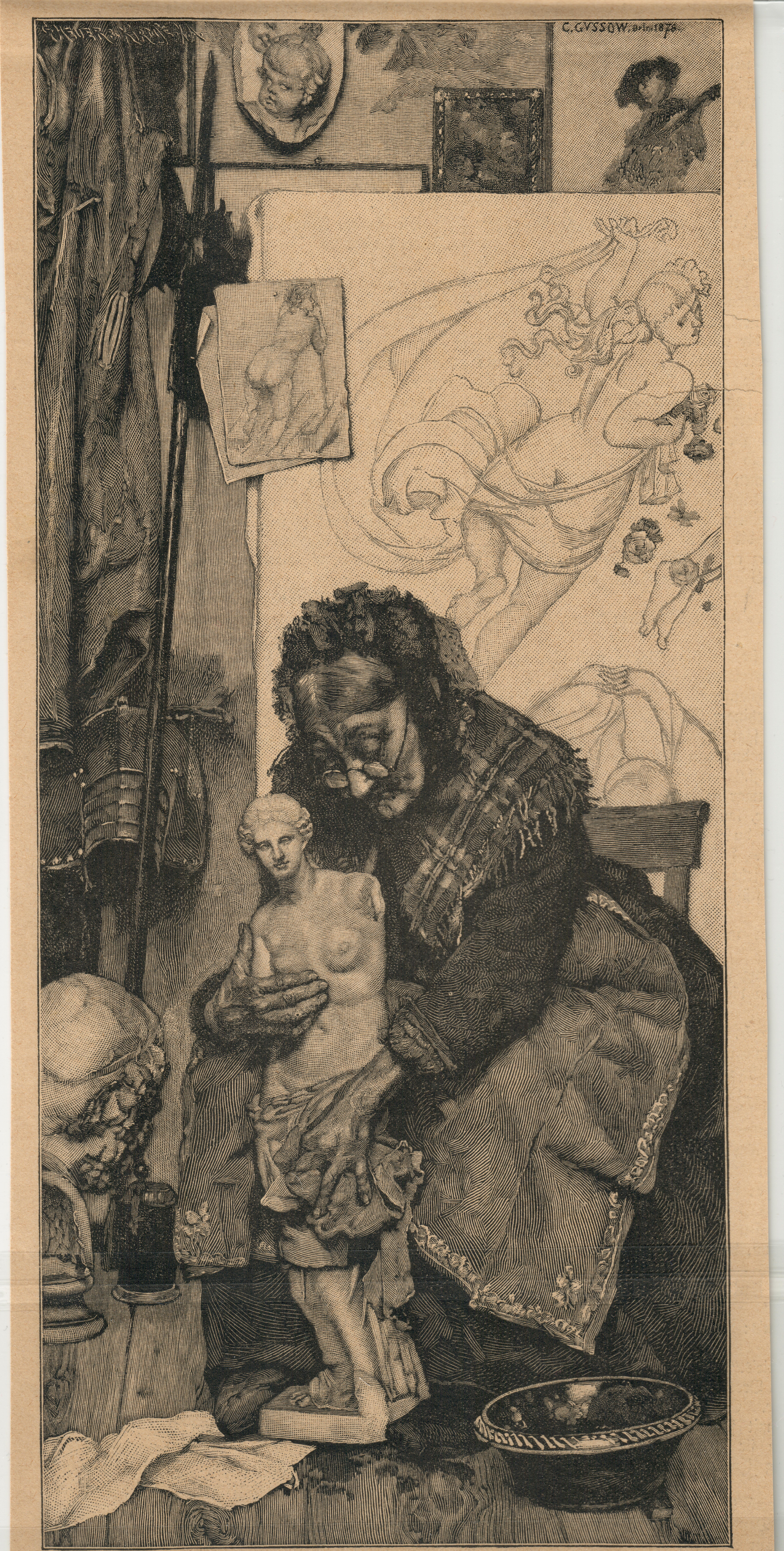
Bild 7. Die Venuswäscherin. Holzschnitt nach einem Gemälde von Carl Gussow von 1878 (Quelle: Moderne Kunst: Illustrierte Zeitung. Jahrgang 1, 1887, Heft 1, Tafel VII; gemeinfrei).
Literatur
- Walther Stephan: Erinnerungen an Carl Gussow. Kiel, um 1950, unveröffentlichtes Manuskript (Kunstbibliothek Berlin, Signatur RA G 11070 r mtl).
- Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Gussow.
- Julius Levin: Moderne Modemaler: Karl Gussow, Karl Becker, Knut Ekwall, Nathanael Sichel; Mahnruf an Künstler und Publikum. Berlin, Von Walther und Apolant 1887.
- Archiv der Akademie der Künste (ADK), Akte 242 sowie Personalakte.
- Kirchenbücher des Kirchenkreises Weimar bei www.Archion.de.
- Paul Enck, Gunther Mai, Michael Schemann: Die Familie Lüderitz. Geschichte und Geschichten aus drei Jahrhunderten. Hayit Verlag, Köln 2024 (2. Auflage).
- Bauakte im Landesarchiv Berlin, Nr. B Rep. 202 Nr. 21967a.
- Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Großheim.
- Verein der Berliner Künstlerinnen, Hrsg. Käthe, Paula und der ganze Rest. Ein Nachschlagewerk. Berlin, Selbstverlag 1992.
- Horst Ludwig et al.: Münchner Maler im 19. Jahrhundert – Bruckmanns Lexikon der Münchner Kunst, Band 2, S. 67f.
- Er zeichnete sich im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 in der Erstürmung der Düppeler Schanzen (Südjüdland) durch besondere Umsicht aus und wurde mit einem Orden ausgezeichnet.
